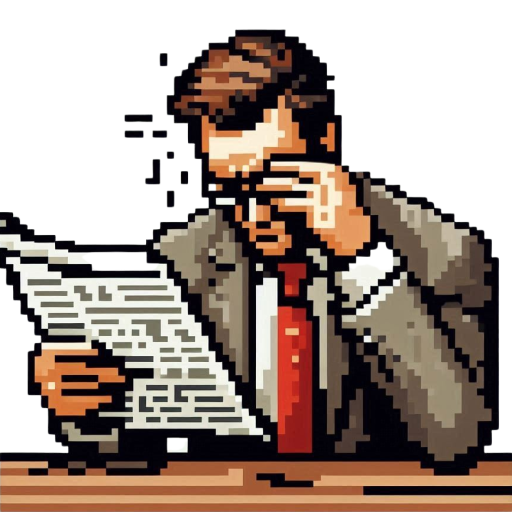“Sahl bin Hunaif und Qais bin Sa’d saßen in der Stadt Al-Qadisiya. Ein Trauerzug fuhr vor ihnen vorbei und sie standen auf. Ihnen wurde gesagt, dass es sich um den Trauerzug eines der Bewohner des Landes handelte, d.h. eines Nicht-Muslims, der unter dem Schutz der Muslime stand.
Sie sagten: ,Ein Leichenzug kam vor dem Propheten (ﷺ) vorbei, und er stand auf. Als er erfuhr, dass es der Sarg eines Juden war, sagte er: ‘Ist es nicht auch eine Seele?’’”
Sahih al-Bukhari 1312
Das islamische Recht betrachtet die Rechte von Minderheiten auf zwei Ebenen: individuell und gemeinschaftlich. Das Individuum, das einer Minderheit angehört, wird als „Dhimmi“ bezeichnet; die Minderheitengruppe als Kollektiv wird als „Millah“ oder „Millet“ bezeichnet(vgl. Recep Şentürk, „Millet „; TDV Islam Ansiklopedisi [Türkische Enzyklopädie des Islam], Band 29 (Istanbul: Zentrum für Islamische Studien [ISAM], 2003)).
In der klassischen islamischen Rechtswissenschaft bedeutet der Begriff „Dhimma„, Rechenschaftspflicht bzw. Verantwortlichkeit und Unverletzlichkeit. Dhimma zu haben ist ein Privileg, das einen dazu berechtigt, ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft zu sein. Die Rechenschaftspflicht vor dem Gesetz ist eine Voraussetzung für die Mitgliedschaft in der Gesellschaft, die mit dem Recht auf vollständige Unverletzlichkeit einhergeht.
„Dhimma“ wird gemeinhin auch als „Schutz“, „Vertrag“ (‚ahd) und „Frieden“ (sulh) verstanden, da es sich um einen Vertrag handelt, der Nicht-Muslime unter den Schutz der Muslime stellt. Es bedeutet, dass eine Person dem Gesetz unterstellt ist oder unter seinem Schutz steht.
Demnach haben alle Menschen aufgrund ihres Menschseins „Dhimma“. Der Begriff „Ahl Al-Dhimma“ gilt daher buchstäblich für alle Menschen auf der ganzen Welt, denn alle Menschen werden mit Dhimma geboren. Die Tatsache, dass nicht-muslimische Minderheiten üblicherweise so genannt werden, zeigt, dass auch nicht-muslimische Minderheiten das Recht auf eine Rechtspersönlichkeit haben und dass sie ihre Verantwortlichkeit anerkennen.
“Mudschahid berichtete, dass ein Schaf für ‚Abdullah Ibn ‚Amr geschlachtet wurde.
Er fragte einen Diener: „Hast du unserem jüdischen Nachbarn etwas geschenkt? Ich hörte den Gesandten Allahs ﷺ sagen: ,Dschibril hat mir immer wieder empfohlen, meine Nachbarn gut zu behandeln, bis ich dachte, er würde sie zu Erben erklären.‘“
Al-adab al-mufrad
Universelle Menschenrechte im Islam
Im Islam gilt die Maxime: „Die Menschenrechte/Unverletzlichkeit/Würde stehen der Menschheit (allein aufgrund ihres Menschseins) zu.“ – auf Arabisch: „al-‚ismah bi al-adamiyyah„. Dieser Leitspruch geht auf den Stifter der größten islamischen Denkschule Abu Hanifa (699-767 n. Chr.) zurück (vgl. al-Marghinani, al-Hidayah Sharh Bidayah al-Mubtadi, 852 und 865).
Die Menschenrechte sind demnach angeboren, universell, unverdient, unveräußerlich und unterscheiden sich daher nicht von Individuum zu Individuum oder von Gemeinschaft zu Gemeinschaft. Die Kinder Adams haben überall auf der Welt Anspruch auf diese Rechte, unabhängig von ihrer Rasse, ihrem Geschlecht, ihrer Sprache und ihrer Religion. Der Begriff „Adamiyyah“ ist eine Abstraktion, die von den Rechtsgelehrten verwendet wurde, um die „Menschheit“ auf universeller Ebene zu bezeichnen, die sowohl Männer als auch Frauen, Muslime und Nicht-Muslime umfasst.
Muslimische Rechtsgelehrte sind sich einig, dass eine Person, die Anspruch auf „‚ismah“ hat, das genießt, was in den modernen Menschenrechten als „Grundrechte“ oder „unwiderrufliche Rechte“ bezeichnet wird. Sie bestehen aus:
- dem Recht auf Leben (‚ismah al-nafs oder ‚ismah al-dam)
- dem Recht auf Eigentum (‚ismah al mal)
- dem Recht auf Religion (‚ismah al-din)
- dem Recht auf Vernunft und Denken (‚ismah al-‚aql)
- dem Recht auf Familie und Nachkommenschaft (‚ismah al-nasl)
- dem Recht auf Ehre (‚ismah al-‚ird)
Die klassischen muslimischen Rechtsgelehrten sind sich einig, dass der Schutz dieser Rechte der Zweck aller Rechtssysteme ist. Daher werden diese Rechte auch als „Ziele des Rechts“ (maqasid al-sharia) bezeichnet. Folglich hat keiner der muslimischen Rechtsgelehrten der klassischen Ära behauptet, der Islam sei die erste Religion, die den Menschen diese Rechte gewährt. Stattdessen behaupteten sie, dass die Gewährung dieser Rechte an alle Menschen immer das gemeinsame Merkmal aller Religionen und Rechtssysteme gewesen sei.
Kollektivrechte im islamischen Recht
In dem Aspekt der individuellen Menschenrechte ist ein nicht-muslimischer Minderheitsangehöriger einem muslimischen Mehrheitsangehörigen demnach laut islamischem Recht ebenbürtig. Auf der Ebene der Kollektivrechte hingegen macht das islamische Recht Unterschiede zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen geltend.
„Strukturell gesehen gewährte das klassische islamische Recht den nicht-muslimischen Gemeinschaften das Recht auf weitgehende Autonomie bzw. Selbstbestimmung in ihren inneren Angelegenheiten in Bezug auf Bildung, Steuererhebung, Recht und Religion sowie die Befreiung vom Militär- und Staatsdienst. Bei Bedarf handelten die Führer der Millets die Höhe der Jizya mit dem Staat aus. Sie gründeten und verwalteten auch ihre eigenen Institutionen wie Gotteshäuser, Schulen, Gerichte und religiöse Stiftungen.“
Şentürk, Recep. „Minority Rights in Islam: From Dhimmi to Citizen“. In Islam and Human Rights: Advancing a US-Muslim Dialogue, herausgegeben von Shireen T. Hunter und Huma Malik, Significant Issues Series:48–69. Washington, D.C.: Center for International and Strategic Studies (CSIS), 2005. 82.
Minderheiten dürfen ihr eigenes religiöses Recht in vollem Umfang ausüben, sofern es nicht im Widerspruch zu den sechs axiomatischen Grundsätzen des islamischen Rechts, die oben genannt sind, steht. Wenn Praktiken ausdrücklich gegen diese Grundrechte verstoßen, wurden sie verboten, so etwa die Praxis der Witwenverbrennung (Sati) in Indien oder die Heirat mit Geschwistern bei einigen Zoroastriern im Iran.
„Im Großen und Ganzen erkennt das islamische Recht zwei große Gruppen an: Das muslimische Millet und das nicht-muslimische Millet, jeweils mit Unterteilungen. Das muslimische Millet ist in zwei Hauptgruppen unterteilt – Schiiten und Sunniten –, die wiederum jeweils Untergruppen haben, von denen jede Madhhab genannt wird (was sich auf eine Rechtsschule bezieht). Die Untergruppen des nicht-muslimischen Millet werden ebenfalls als Millet bezeichnet. Die institutionelle Organisation, in der all diese Gruppen horizontal miteinander und vertikal mit dem muslimischen Herrscher verbunden sind, wird als Millet-System bezeichnet. Diese pluralistische Sozial- und Rechtsstruktur wurde durch eine bestimmte Auffassung von „normativer Wahrheit“ begünstigt. Der pluralistische theologische Ansatz für rechtliche und moralische Normen ermöglichte die Koexistenz verschiedener Millets und Madhhabs nebeneinander in einer Gesellschaft.“
Şentürk, „Minority Rights in Islam: From Dhimmi to Citizen“.79.
Dabei mussten nicht-muslimische Minderheiten in muslimischen Ländern gemäß klassischem islamischen Recht als „Millets“ unter ihren religiösen Führer organisiert sein und ihrem kanonischen Recht folgen. Der Millet-Status und die damit verbundenen Rechte werden nicht nur den christlichen und jüdischen Gemeinschaften – die als „Gemeinschaft des Buches“ (Ahl al-Kitab) gelten – gewährt, sondern auch den Zoroastriern im Iran und den Hindus und Buddhisten in Indien. Folglich gelang es im Laufe der islamischen Geschichte einer großen Zahl von muslimischen und nichtmuslimischen Gemeinschaften, ihre Identität und Kultur zu bewahren (Vergleiche Braude and Lewis, Christians and Jews in the Ottoman Empire). Das bedeutet nicht, dass es keine diskriminierenden Praktiken gegenüber Nicht-Muslimen gab, insbesondere wenn man die modernen Menschenrechtsstandards betrachtet.
“(…) die permanenten Bewohner der Sphäre des Islam, die ahl al-dimma (die unter Schutz stehenden Leute), die von einer dritten Möglichkeit profitieren: dem Privileg, im Gegenzug zu Sicherheit und der mehr oder weniger freien Religionsausübung ohne Zwang zur Konversion Tribut zu zahlen. Somit lebten die jüdischen und christlichen dimmis, auch wenn sie marginalisiert waren, in einer anerkannten, festgelegten und geschützten Nische innerhalb der Hierarchie der islamischen Gesellschaftsordnung.”
Cohen, Mark R. Unter Kreuz und Halbmond: die Juden im Mittelalter. 2. Auflage. München: Beck, 2011.