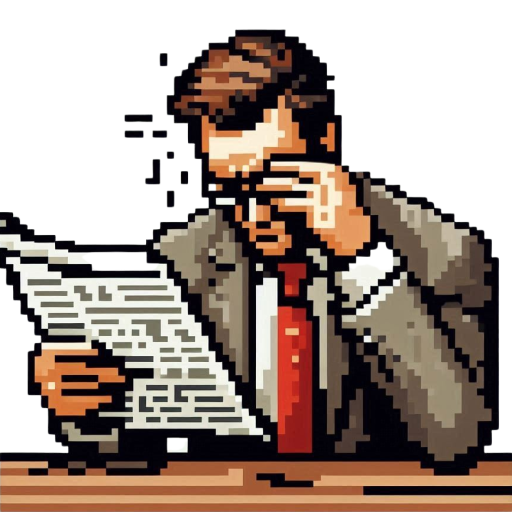„Halal“ ist Arabisch und steht für „erlaubt“ und kennzeichnet, ob eine Aktion für Muslime gestattet ist oder nicht. Populär ist die Verwendung dieses Wort insbesondere in der Beurteilung von Speisen, die bestimmten Kriterien genügen müssen. Viele Regeln, die eine Speise „halal“ machen, sind dabei sehr ähnlich zu den jüdischen Speisegesetzen („koscher“, vgl. Kaschrut). Wenn etwas halal oder koscher ist, dann wissen wir: Es ist rein, sauber, gut. Halal bedeutet Vertrauen, Transparenz über die Herkunft von Fleisch und die Inhaltsstoffe einer Speise. Das heißt auch: Dort, wo ich als Muslim kein Halal-Fleisch bekomme, kaufe ich ohne zu zögern beim jüdischen Metzger. Denn da weiß ich um die Qualität.
Die Tierart und Schlachtung spielen eine Rolle
Nur das Fleisch bestimmter Tiere, wie etwa vom Rind, Schaf oder Hühner, darf konsumiert werden, nachdem es auf eine bestimmte Art gehalten und geschlachtet wurde. Das Schlachten eines Tieres erfordert im Islam in der Regel die Schächtung. Das heißt, dem Tier werden Schlagader, Speise- und Luftröhre mit einem einzigen, sauberen Schnitt durch ein explizit scharfes und langes Messer durchtrennt. Ziel ist, dass das Tier das Bewusstsein verloren hat bevor der Metzger bis zwei zählen kann. Kurze Zeit darauf ist es auch schon tot. Die Schächtung dient also zugleich der Betäubung des Tieres.
Zahlreiche Wissenschaftler haben das Schächten – ohne Betäubung – geprüft, und sind zum Schluss gekommen, dass es für die Tiere sogar weniger schmerzhaft sein kann als das konventionelle Schlachten, wenn es regelkonform ausgeführt wird. [Am Ende finden sich beispielhafte Aufsätze aus einschlägigen wissenschaftlichen Zeitschriften].
Bei der Untersuchung stressbedingter Hormone (Adrenalin, Noradrenalin und Corticosteron) bei Masthühnern etwa wurde klar, dass sowohl die Plasmaspiegel von Adrenalin als auch von Corticosteron während der Betäubung statistisch signifikant höher waren als bei den anderen Proben.
Zulkifli, I, Z Wakiman, A.Q. Sazili, Y.M. Goh, A Jalila, Z Zunita, und E.A. Awad. „Effect of shackling, electrical stunning and halal slaughtering method on stress-linked hormones in broilers“. South African Journal of Animal Science 49, Nr. 3 (25. Juni 2019): 598. https://doi.org/10.4314/sajas.v49i3.20.
Bei der konventionellen Betäubung mit Bolzenschuss hingegen wird das Tier – so lautet die Kritik aus akademischen Kreisen – unnötigem Stress ausgeliefert, und kann sogar, anders als gewünscht, noch mehr Schmerzen empfinden.
Woher die Vorurteile gegen das Schächten stammen
Das Schächten ist unabdingbarer Teil der jüdischen und islamischen Speisegesetze, dennoch gilt es in Deutschland als „grausam“. Viele wissen aber nicht, dass diese Zuschreibung seinen Ursprung in der antisemitischen Ideologie des Nationalsozialismus hat. Es war den menschenfeindlichen Nazis so wichtig, dass sie nur vier Monate nach der Machtergreifung diese jahrtausendealte Technik gesetzlich verboten.
Der Grund? In der Präambel des Reichstierschutzgesetzes heißt es: „Die überwältigende Mehrheit des Deutschen Volkes hat schon lange das Töten ohne Betäubung verurteilt, eine Praxis, die unter Juden allgemein verbreitet ist.“ Von wegen Tierschutz! Es ging um die Dämonisierung von Juden und den Erlass eines antisemitischen Gesetzes. Besonders kurios, weil das Reichsgesundheitsamt 1930 das Schächten vom Vorwurf der Tierquälerei freisprach.
Klar ist: Das Schächten ist mit dem Tierwohl vereinbar. Nichtsdestotrotz blieben die von den Nationalsozialisten strategisch geschürten Ressentiments leider unbewusst in Teilen unserer Gesellschaft erhalten.
Besonders paradox: Während das Schächten ohne Betäubung in der deutschen Rechtsprechung grundsätzlich mit Verweis auf das Tierwohl verboten ist, gelten lange, überflüssige Tiertransporte und beengte Massentierhaltung hingegen als artgerecht und mit dem Tierwohl vereinbar. Das können wir besser!
Quellen
- Aghwan, Z.A., A.U. Bello, A.A. Abubakar, J.C. Imlan, and A.Q. Sazili. ‘Efficient Halal Bleeding, Animal Handling, and Welfare: A Holistic Approach for Meat Quality’. Meat Science 121 (November 2016): 420–28. https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2016.06.028.
- Bager, F., T.J. Braggins, C.E. Devine, A.E. Graafhuis, D.J. Mellor, A. Tavener, and M.P. Upsdell. ‘Onset of Insensibility at Slaughter in Calves: Effects of Electroplectic Seizure and Exsanguination on Spontaneous Electrocortical Activity and Indices of Cerebral Metabolism’. Research in Veterinary Science 52, no. 2 (March 1992): 162–73. https://doi.org/10.1016/0034-5288(92)90005-M.
- Grandin, T. ‘Euthanasia and Slaughter of Livestock’. Journal of American Veterinary Medical Association 204 (1994): 1354–1360.
- Grandin, T., and J. M. Regenstein. ‘Religious Slaughter and Animal Welfare: A Discussion for Meat Scientists’. Meat Focus International, 1994, 115–123.
- Lerner, Pablo, and Alfredo Mordechai Rabello. ‘The Prohibition of Ritual Slaughtering (Kosher Shechita and Halal) and Freedom of Religion of Minorities’. Journal of Law and Religion 22, no. 1 (2006): 1–62. https://doi.org/10.1017/S0748081400003210.
- Pozzi, Paolo, Wassim G., Barakeh S., and Mohammad Azaran. ‘Principles of Jewish and Islamic Slaughter with Respect to OIE (World Organization for Animal Health) Recommendations’. Israel Journal of Veterinary Medicine 70 (1 September 2015): 3–16.
- Pozzi, Paolo S., and Trevor Waner. ‘Shechita (Kosher Slaughtering) and European Legislation’. Veterinaria Italiana 53, no. 1 (2017): 5–19.
- Rosen, S. D. ‘Physiological Insights into Shechita’. Veterinary Record 154, no. 24 (12 June 2004): 759. https://doi.org/10.1136/vr.154.24.759.
- Zivotofsky, Ari Z. ‘Government Regulations of Shechita (Jewish Religious Slaughter) in the Twenty-First Century: Are They Ethical?’ Journal of Agricultural and Environmental Ethics 25, no. 5 (October 2012): 747–63. https://doi.org/10.1007/s10806-011-9324-4.